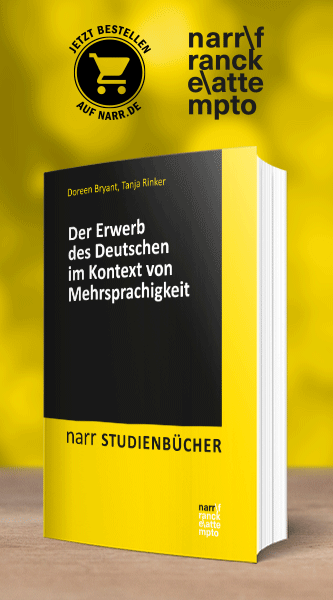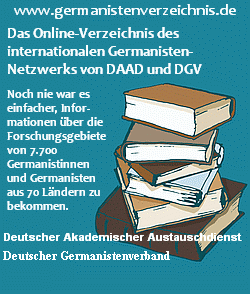Issue 1/2024 - ISSN 1470-9570
ARTICLES
Einleitung: Deutsch als ‚Ergänzungssprache‘ in europäischen Gesellschaften: Kontexte, Funktionen und sprachenpolitische Implikationen
Heiko F. Marten, Mannheim & Rēzekne & Alja Lipavic Oštir, Maribor & Trnava (pages 1-14)
This paper introduces the readers to this thematic issue of GFL on German as ‘additional language of society’ in European countries. Point of reference is Marten’s (2021a, 2021b, 2023) observation of multilingualism in the Baltic states, where German is today neither an official language nor a lingua franca such as English. Yet, it has more historically rooted and contemporary functions than many other languages. The papers in this volume discuss advantages and limits of this conceptualisation and its relevance for other countries, from a perspective of Slovenia, Bosnia-Hercegovina, North Macedonia, Lithuania, Latvia, and Belgium. The discussion includes aspects of sociolinguistics and language policy, of acade¬mic languages or language marketing. In total, the articles show that the concept of ‘additional language of society’ may be of particular relevance in the Eastern half of Europe; at the same time, the issue is an invitation to contemplate its application to other situations and regions.
Die Stellung der deutschen Sprache in Slowenien
Katarina Tibaut & Alja Lipavic Oštir, Maribor (pages 15-40)
This article provides an overview of the position of the German language in Slovenia. Four perspectives are examined: history, education, economy and migration. These perspectives are interrelated and shape the importance of German in Slovenia. Although the German language plays an important role in the economy (including tourism, trade, service culture) and in the context of migration, the status of German in the school system is characterized by an inconsistent language policy, which does not adequately reflect the actual demand.
Zum dynamischen Status von Deutsch in Slowenien einst und heute: Einige Überlegungen zu ‚weniger sichtbaren‘ gesellschaftlichen Funktionen
Uršula Krevs Birk, Ljubljana (pages 41-64)
The article discusses the position of the German language in Slovenia in the past as well as two less socially exposed functions of German in Slovenian society: German as a minority language and migration-related German. German is not an official language in Slovenia, but many other conceptualisations of German also apply to German in Slovenia, e.g. German as a foreign language, German in the economy, in tourism, etc. In order to focus on the two functions of German in today’s Slovenia, the article presents a review of the intensive language and cultural contacts between German and Slovene, focusing on the social status of German in the Slovene language area. After 1918, the territory of Slovenia was assigned to the new South Slavic state, the Kingdom of SHS. This political change had lasting consequences for the position of German in Slovene society. From the sociolinguistic point of view of German in Slovenia, two socially less visible aspects of German can be identified: From the 1960s until today, various forms of migration – from guest workers to cross-border commuters – can be observed, which generate individual multilingualism with German and Slovene and/or another mother tongue or language of origin. Another less visible function in Slovenian society is German as a minority language, whose current position is strongly connected to the history of language contacts and the social significance of German in the past.
Die Rolle der deutschen Sprache in Bosnien und Herzegowina während der Regierung der österreichisch-ungarischen Monarchie
Sanja Radanović, Banja Luka (pages 65-83)
This article discusses different roles of the German language in Bosnia and Hercegovina during the rule of the Austro-Hungarian Empire from 1878 to 1918. Depending on the social, economic, and cultural conditions, as well as on dominating language policies of the ruling power, functions of a language may be highly diverse, including mother tongue, foreign language, official language, or language of broader communication. This article aims at describing the roles of German in Bosnia and Hercegovina in the given period in different areas of social life: in education, administration, the legal system, and the press. Considering its importance and presence in Bosnian society, it might be legitimate to argue that the German language played a role as ‘additional language of society’.
Das Deutsche in Nordmazedonien: Aufstieg zum Spitzenreiter der zweiten Fremdsprachen-Liga
Emina Avdić & Emilija Bojkovska, Skopje (pages 84-115)
The aim of this paper is to categorize the position of the German language in North Macedonia. Based on the language diversity in the country, first the a) national language policy, which regulates the use of the official languages and the languages of the (ethnic) communities, and then b) the foreign language policy, which promotes the learning of foreign languages in the education system, are considered. Using statistical data and supplementary findings of its own, the study examines German from the perspective of its use as a first, second and foreign language. The study shows that the most important status of German as a second foreign language is anchored in lower and upper secondary education and in adult education. Finally, the question is answered as to whether German in North Macedonia can be characterized as an additional language of society”.
Deutsch als Ergänzungssprache in ausgewählten Bereichen Litauens
Eglė Kontutytė & Vaiva Žeimantienė, Vilnius (pages 116-137)
Marten (2021) discusses the position of the German language in the Baltic States and thus also in Lithuania and proposes the conceptualisation of the German language in the region as an “additional language of society”. The present article uses concrete examples to show the position of the German language in contemporary Lithuanian society, focusing espe¬cially on its occurrence in Lithuanian online media, reflecting the areas of use and the role of German. After that, we describe the situation and profiles of German studies in higher education and demonstrate the role of German in research on the basis of scholarly publications in Lithuania. Finally, we outline the position of German in the Lithuanian economy on the basis of studies and the representation of the German language in the media.
Špūren einer Ergänzungssprache? Zur Präsenz des Deutschen im litauischen Alltag anhand eines Fotowettbewerbes
Alexander Mionskowski, Budapest & Leipzig (pages 138-163)
This article discusses the results of a photo competition organised at the University of Vilnius, based on the sociolinguistic approaches of Linguistic Landscapes and Spot German. It was carried out by several academic institutions and schools in Lithuania engaged in German as a Foreign Language in cooperation with different actors of German foreign cultural policy in the country and took place between several longer periods of Covid-19 related lockdowns. The title “Špūren”, a sub-standard Germanism consisting of a German lexeme in Lithuanian orthography, was chosen in order to symbolise the creative potential of the co-existence of languages in everyday life in Lithuania. This choice received positive feed-back and may potentially serve as a brand, as shown by the restart of the concept after one year. The article first explains the background and fundamental considerations in creating the competition, its addressees, the rating process and the media involved. Then, it discusses the 20 entries which were chosen as winners and summarises information on their backgrounds and the places where the pictures were taken. The analysis shows that the entries are rooted in everyday functional contexts, which usually provide clear information about the reasons and aims of choosing German. Finally, the article discusses the academic value of the competition for understanding the role of German in Lithuania in the context of the concept of “additional language of society”.
Zur Rolle des Deutschen als gesellschaftlicher Ergänzungssprache in einem internationalen Projekt zum mehrsprachigen Arbeiten im DaF-Unterricht
Anta Kursiša, Stockholm (pages 164-186)
Der Beitrag stellt das Projekt exemplarisch aus der Perspektive Lettlands als eines der teilnehmenden Länder vor. Die Diskussion der sprachen- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen sowie der Rolle des Deutschen bildet die Grundlage für die Einschätzung der Erfolgsaussichten eines Projektes für den DaF-Unterricht, in dem Deutsch nicht als Ziel-, sondern als Ausgangs- und Kommunikationssprache für die sprachliche Arbeit fungiert. Eine wichtige Schlussfolgerung ist dabei, dass die deutsche Sprache den Ausgangspunkt für die Bearbeitung der Themen im Projekt bilden kann, weil sie in Lettland bzw. in der gesamten Ostsee-Region als gesellschaftliche Ergänzungssprache fungiert.
In the academic year 2021-2022, the project “Language Expedition around the Baltic Sea” was conducted on behalf of the Goethe Institute in several Northern European countries. The teaching material created in the project, had the aim of helping students to engage with their own multilingualism and the languages in the participating countries. During a series of workshops, the participating teachers were introduced to the topic and the objectives of the project as well as to the tasks for the students.
This article presents the project from the perspective of Latvia as one of the participating countries. The discussion of the language and education policy framework and the role of German, forms the basis for assessing the prospects of success of a project for GFL teaching in which German is not the target language, but the source and communication language. The paper concludes that the German language can serve as a suitable point of departure for work on the project’s topics, as it functions as an additional language of society in Latvia and the entire Baltic Sea region.
Zwischen Gesellschaft und Staat: die Kategorie ‚Ergänzungssprache‘ aus belgischer Sicht
Torsten Leuschner, Gent (pages 187-213)
The role of German as an ‘additional language’ (Ergänzungssprache) has been approached mainly from a North-Eastern European vantage point in the literature so far. The present article, by contrast, adopts the Belgian perspective. This seems a natural choice given that the Belgian constitution divides the country’s territory into three linguistically delineated regions with respectively Dutch, French and German as the sole official language, thus raising two questions: does German perhaps function as an ‘additional language of society’ (gesellschaftliche Ergänzungssprache) in the two non-Germanophone regions? If not, what added value might the category of ‘additional language’ yet bring to the Belgian context? The article begins with a survey of the role, both official and practical, of German in Belgian multilingualism, demonstrating that German is in fact a foreign language in the non-Germanophone regions and is far from functioning as an additional language of society. Another way of rendering the traditionally sociolinguistic concept of ‘additional language of society’ useful for Belgium, would be to re-define it in legal terms as ‘additional language of the state’ and to include Dutch and/or French as well as German as respective additional languages of the regions in any future settlement for an ever more federalized Belgium. While this may look like the final squaring of the circle for German, a reality check suggests that such plans will remain politically unrealistic for the foreseeable future. In the meantime, ‘additional language of society’ could serve as a reference for campaigns and activities designed to strengthen both the marketing of and the demand for German in the non-Germanophone regions of Belgium, analogous to suggestions made in the literature with regard to the Baltic countries.